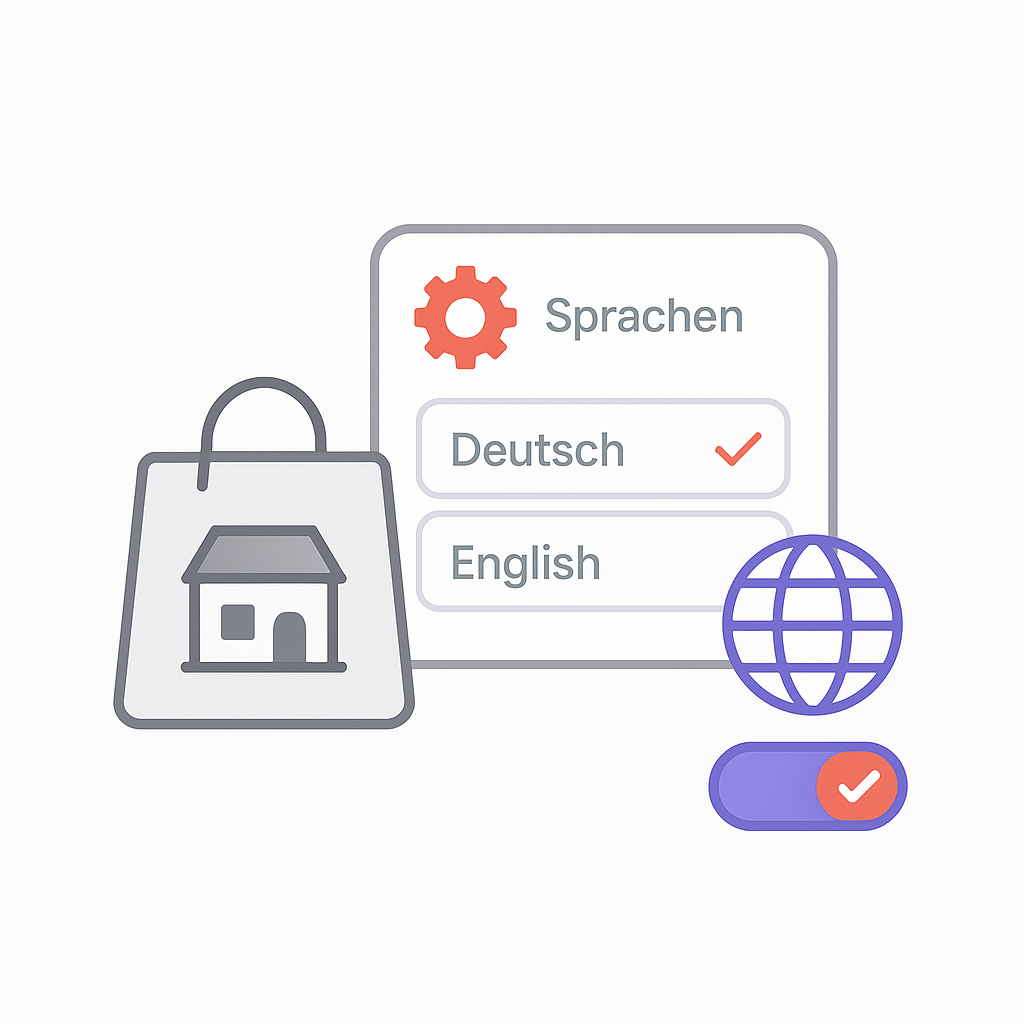Beim Einstieg in den Online-Verkauf stehen Unternehmer vor einer wichtigen Entscheidung: Verkaufe ich meine Produkte über einen eigenen Onlineshop oder nutze ich die Plattform Amazon? Beide Optionen haben spezifische Vor- und Nachteile. In diesem Ratgeber werden die wichtigsten Aspekte objektiv verglichen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Wir beleuchten unter anderem: Kostenstruktur, Reichweite und Kundenzugang, Markenbildung und Kundenbindung, Kontrolle über Design, Prozesse und Daten, Logistik und Fulfillment, Marketingmöglichkeiten, Skalierbarkeit sowie Risiken und Abhängigkeiten. Am Ende finden Sie einen zusammenfassenden Vergleich und Entscheidungshilfen.
1. Kostenstruktur: Startkosten, laufende Gebühren und Transaktionsgebühren
Eigener Onlineshop: Der Aufbau eines eigenen Shops erfordert anfangs Investitionen in Technik und Design. Sie benötigen mindestens eine Domain und Webhosting sowie ein Shopsystem (z.B. Shopify, WooCommerce, Shopware). Fertige Shopsysteme erleichtern den Start, verursachen aber monatliche Kosten je nach gewähltem Tarif – beispielsweise kostet ein Basis-Paket bei Shopify aktuell rund 27 € pro Monat. Hinzu kommen einmalige Entwicklungskosten (wenn Sie ein individuelles Design oder Programmierung benötigen) oder Kosten für Plugins/Themes. Außerdem fallen Transaktionsgebühren der Zahlungsanbieter an (z.B. ~2–3% pro Zahlung über Kreditkarte oder PayPal). Marketingkosten (z.B. für SEO, Werbung) sind ebenfalls einzuplanen, um Besucher in den Shop zu bringen. Die laufenden Kosten für einen eigenen Shop sind größtenteils fix (monatliche Gebühren für Shopsystem, Hosting, ggf. Personal) – unabhängig davon, wie viel Sie verkaufen.
Amazon: Auf Amazon sind die Einstiegskosten geringer. Sie können sofort ein Verkäuferkonto eröffnen und Produkte listen, ohne eine eigene Website erstellen zu müssen. Für professionelle Verkäufer fällt eine monatliche Grundgebühr von ca. 39 € (zzgl. USt.) an (für das „Professional“-Verkäuferkonto), alternativ gibt es ein kostenloses Modell mit 0,99 € pro verkauftem Artikel für Gelegenheitsverkäufer. Die Hauptkosten entstehen transaktionsbasiert: Amazon erhebt für jedes verkaufte Produkt eine Verkaufsprovision von meist 8% bis 15% des Verkaufspreises (je nach Kategorie). Zusätzlich können Fulfillment-Gebühren anfallen, falls Sie Versand durch Amazon (FBA) nutzen. FBA umfasst Lagerung, Verpackung, Versand und Retourenbearbeitung Ihrer Waren – bequem, aber gegen Gebühr. Diese Gebühren können sich vor allem bei sperrigen, schweren oder langsam drehenden Artikeln erheblich summieren. Zwar sparen Sie mit Amazon die Kosten für den Aufbau eines eigenen Shops, müssen aber einen Teil Ihres Umsatzes abtreten (bis zu ~15% und mehr, plus Lager-/Versandgebühren).
Vergleich: Kurz gesagt verursacht ein eigener Shop höhere Fixkosten am Anfang (Setup, laufende Systeme) und erfordert eigenes Marketingbudget, bietet aber langfristig die Chance auf höhere Margen pro Produkt, da keine Marktplatz-Provision anfällt. Amazon hingegen hat weniger Startaufwand und fixe Kosten, rechnet aber über verkaufsabhängige Gebühren ab – dadurch zahlen Sie nur bei tatsächlichem Umsatz, allerdings können die Gebühren Ihre Gewinnspanne deutlich schmälern.
2. Reichweite und Kundenzugang
Amazon: Ein entscheidender Vorteil von Amazon ist die enorme Reichweite und bestehende Kundenbasis der Plattform. 50–70 % aller Produktsuchanfragen beginnen heutzutage direkt auf Amazon. Das bedeutet: Wer auf Amazon nicht präsent ist, verzichtet auf einen Großteil potenzieller Käufer, die gezielt dort nach Produkten suchen. Amazon verzeichnet Millionen von Besuchern täglich und genießt großes Vertrauen der Verbraucher. Ihre Produkte profitieren von dieser Sichtbarkeit – Kunden stoßen oft nebenbei auf Ihr Angebot, etwa durch Empfehlungsalgorithmen („Kunden, die X ansahen, interessierten sich auch für Y“). Gerade international öffnet Amazon Türen: Mit einem einzigen Marktplatz-Zugang können Sie Käufer in verschiedenen Ländern erreichen, ohne sich separat um jede Landeswebsite kümmern zu müssen. Außerdem strahlt Amazons Bekanntheit und Glaubwürdigkeit auf Händler ab: Viele Kunden vertrauen auf Amazons sicheres Einkaufserlebnis und kaufen eher bei einem unbekannten Händler auf Amazon, als in einem unbekannten Einzelshop.
Eigener Onlineshop: Im eigenen Shop müssen Sie sich die Reichweite erst aufbauen. Anfangs ist Ihr Shop praktisch unbekannt – es bedarf aktiver Maßnahmen in SEO, Online-Marketing, Social Media etc., um Besucher zu gewinnen. Ohne gezielte Marketingstrategie wird ein neu gestarteter Shop kaum relevanten Traffic erzielen. Sie müssen also investieren, damit Ihre Seite in Google-Suchergebnissen sichtbar wird oder Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken erhält. Die Kundenzugangshürde ist höher: Kunden müssen gezielt Ihren Shop finden oder Ihre Marke kennen. Positiv ist jedoch, dass Sie die Besucher, die Sie einmal gewonnen haben, direkt ansprechen können (z.B. via Newsletter oder Retargeting – dazu später mehr). Auch lokal oder in Nischen können eigene Shops mit passender Strategie treue Kundschaft aufbauen. Es dauert in der Regel länger, bis ein eigener Shop eine nennenswerte Reichweite und Stammkundschaft hat.
Vergleich: Amazon bietet sofortige Sichtbarkeit in einem riesigen Markt – ideal, um schnell Verkäufe zu erzielen und breite Massen zu erreichen, allerdings um den Preis hoher Konkurrenz (siehe unten) und weniger direktem Kundenkontakt. Ein eigener Shop erfordert zunächst Geduld und Marketingaufwand, um bekannt zu werden, schafft dafür aber unabhängigen Zugang zu Ihrer Zielgruppe langfristig. Viele Unternehmen nutzen anfangs Amazons Marktmacht, um zu testen, ob Produkte ankommen, während parallel die eigene Online-Präsenz aufgebaut wird.
3. Markenbildung und Kundenbindung
Eigener Onlineshop: Für den Markenaufbau und die Kundenbindung ist ein eigener Shop meist unerlässlich. Sie haben die Möglichkeit, ein voll individuelles Markenerlebnis zu schaffen – vom Logo über die Shop-Gestaltung bis zur Tonalität Ihrer Inhalte. Ihr Shop spiegelt Ihr Corporate Design wider und kann mit zusätzlichen Inhalten (Blog, Über-uns-Seiten, Lookbooks etc.) angereichert werden, um eine Markenwelt zu kreieren. Kunden, die Ihren Shop besuchen, werden nicht von Konkurrenzangeboten abgelenkt – im Gegensatz zu Marktplätzen gehört die ganze Aufmerksamkeit Ihrer Marke. Dies erleichtert es, eine Markenloyalität aufzubauen. Zudem können Sie gezielt Stammkunden-Programme einführen (Treuepunkte, personalisierte Angebote) und mit Social-Media-Accounts verknüpfen, um eine Community aufzubauen. Zufriedene Kunden kommen im Idealfall direkt auf Ihre Website zurück, wenn sie erneut kaufen möchten, was den Customer Lifetime Value erhöht. Kurz: Ein eigener Shop ist die ideale Plattform, um Ihre Marke bekannt zu machen und Kunden langfristig zu binden.
Amazon: Auf Amazon steht Ihre Marke im Schatten der großen Plattform. Die meisten Käufer glauben, bei Amazon selbst einzukaufen, nicht bei einem einzelnen Händler. Amazon eignet sich kaum für Markenbildung – Ihr Logo erscheint zwar klein als Verkäufer, aber das gesamte Look&Feel wird von Amazon dominiert. Möglichkeiten, sich als Marke zu präsentieren, sind stark limitiert. Zwar gibt es für registrierte Marken die Option, einen Amazon Brand Store einzurichten und A+ Content (erweiterte Produktbeschreibungen) bereitzustellen, doch diese sind nur auf Ihren Produktseiten sichtbar und spielen in der Kundengewinnung eine geringe Rolle. Selbst auf Ihren eigenen Produktseiten zeigt Amazon oft Werbung für Konkurrenzprodukte („gesponserte Produkte“), was Ihre Markenbotschaft verwässert. Die Kundenbindung ist schwierig: Käufer „gehören“ zu Amazon – sie werden beim nächsten Kauf wieder Amazon aufsuchen und möglicherweise beim günstigsten Anbieter bestellen, statt gezielt wieder bei Ihnen. Eine loyale Community lässt sich auf dem Marktplatz kaum aufbauen, zumal Wiedererkennungseffekte fehlen (viele Händler teilen sich die gleiche Produktseite). Außerdem gibt Amazon Ihnen keine Kundendaten wie E-Mail-Adressen heraus, was Nachfass-Aktionen oder Newsletter-Marketing praktisch unmöglich macht.
Vergleich: Für Branding und Kundenloyalität ist ein eigener Shop klar im Vorteil – hier können Sie Ihre Marke bestmöglich in Szene setzen und direkt mit Kundenbeziehungen arbeiten. Amazon bietet riesige Kundenzahlen, aber aus Sicht der Kunden bleibt Amazon die Marke. Wenn Sie ein eigenes Label oder eine Kollektion etablieren wollen, führt kaum ein Weg am eigenen Shop vorbei. Viele erfolgreiche Verkäufer nutzen Amazon rein für Reichweite, lenken aber die Kundenbindung auf Kanäle außerhalb Amazons (z.B. Social Media, eigene Website auf der Verpackung erwähnen, etc.), um ihre Marke aufzubauen.
4. Kontrolle über Design, Prozesse und Daten
Eigener Onlineshop: Mit einem eigenen Shop genießen Sie volle Kontrolle über Design und User Experience. Sie bestimmen das Layout, die Navigation, die Produktdarstellung und alle Funktionen nach den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe. Ob ausgefallenes Design, spezielle Produktkonfiguratoren oder ein einzigartiger Checkout-Prozess – alles ist möglich, ohne Vorgaben eines Drittanbieters. Ebenso haben Sie Kontrolle über Prozesse: Sie legen z.B. eigene Versand- und Rückgaberichtlinien fest (im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben) und können interne Abläufe gestalten, wie es am besten zu Ihrem Geschäftsmodell passt. Ein großer Pluspunkt ist die Datenhoheit: Sie besitzen alle Kundendaten selbst. Sie können auswerten, wer was gekauft hat, Kaufgewohnheiten analysieren und diese Informationen für Marketing und Produktentwicklung nutzen. Kundenlisten erlauben z.B. personalisierte E-Mail-Kampagnen, Treueaktionen oder gezieltes Upselling, um den Umsatz zu steigern. Auch technische Integrationen haben Sie in der Hand – Sie können Tools für Analytics, CRM, Personalisierung und mehr frei anbinden. Kurz: Ein eigener Shop gibt Ihnen die Gestaltungsfreiheit, Ihr Online-Geschäft nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, und die Daten, um informierte Entscheidungen zu treffen.
Amazon: Auf dem Amazon-Marktplatz bewegen Sie sich in einem stark reglementierten Rahmen. Das Seitenlayout Ihrer Angebotsseiten ist vorgegeben – alle Produkte folgen einem einheitlichen Format für Titel, Bilder, Beschreibung, Rezensionen etc. Ihre Möglichkeiten, die Produktpräsentation anzupassen, sind sehr eingeschränkt. Sie können zwar hochwertige Bilder und gute Beschreibungen einstellen, aber z.B. kein individuelles Design, eigene Kategorietexte oder spezielle Features implementieren. Auch Checkout und Zahlungsabwicklung laufen über Amazon, ohne Spielraum für eigene Prozesse. Kundendaten bleiben größtenteils bei Amazon: Sie erhalten nur die notwendigsten Informationen zur Bestellabwicklung, aber z.B. keine Kundene-Mail für Marketingzwecke. Das bedeutet, Retargeting oder Newsletter an Amazon-Kunden sind praktisch nicht möglich. Außerdem müssen Sie sich an alle Vorgaben und Richtlinien von Amazon halten – von Bildformaten über Verpackungsstandards bis zu Kommunikationsregeln mit Kunden (z.B. keine Werbung für Ihren externen Shop in Amazon-Nachrichten). Bei Verstößen drohen Konsequenzen bis hin zur Kontosperrung. Insgesamt haben Sie auf Amazon weniger Kontrolle und müssen sich dem „Ökosystem Amazon“ unterordnen, was Design und Datenzugang angeht.
Vergleich: Ein eigener Shop bietet maximale Flexibilität in Darstellung und vollständige Datenhoheit, verlangt aber auch, dass Sie sich um alles selbst kümmern (Technik, Analyse, Optimierung). Amazon nimmt Ihnen vieles ab (Designvorgaben, Zahlungsabwicklung), was den Start erleichtert, erkauft dies jedoch mit Kontrolleinschränkungen und Datenabschottung. Wer kreative Marketing-Ideen oder spezielle Shop-Funktionen umsetzen möchte, kann dies nur im eigenen Shop voll realisieren. Auf Amazon sind Sie in ein fertiges Korsett eingebunden – konform, aber dafür sofort funktional.
5. Logistik und Fulfillment (inkl. technischer Aspekte)
Amazon: Amazon verfügt über ein weltweit erstklassiges Logistiknetzwerk. Mit „Versand durch Amazon“ (Fulfillment by Amazon, FBA) können Händler ihre Ware in Amazons Lager schicken – von dort übernimmt Amazon Lagerhaltung, Verpackung, Versand und sogar Retouren. Produkte, die via FBA geliefert werden, erhalten das begehrte Prime-Logo, was bei vielen Kunden das Vertrauen und die Kaufbereitschaft steigert. FBA ermöglicht es auch kleinen Verkäufern, schnelle Lieferzeiten und professionellen Versand anzubieten, ohne eigene Logistikinfrastruktur – ideal, um skalierend zu verkaufen, ohne ein eigenes Lagerhaus aufzubauen. Allerdings hat dieser Komfort seinen Preis: Lagergebühren, Pick-&-Pack-Gebühren, Versandkosten nach Gewicht/Größe, Gebühren für Remission (Rücksendung ans Lager) etc. kommen hinzu. Besonders für schwere, große oder sehr günstige Produkte können FBA-Gebühren die Marge stark belasten. Zudem verlieren Händler bei FBA teilweise die Kontrolle über das Versand-Erlebnis: Amazon verschickt in Amazon-Kartons, legt eigene Flyer bei, bestimmt die Retourenabwicklung – Ihr Einfluss auf Verpackung und Unboxing-Erlebnis ist gering. Alternativ bietet Amazon auch die Möglichkeit des Selbstversands (FBM): Hier lagern und versenden Sie selbst an den Endkunden. Dann müssen Sie jedoch Amazons hohe Standards (schneller Versand, pünktliche Lieferung, Tracking, Kundendienst bei Versandfragen) erfüllen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Technisch stellt Amazon ein Verkäuferportal und Schnittstellen bereit, über die Sie Bestellungen abrufen und Versandmeldungen zurückspielen können; viele Händler nutzen externe Versandsoftware, um Amazon-Bestellungen effizient zu verarbeiten. Amazon besitzt also eine funktionierende Infrastruktur, in die Sie sich einklinken – dafür zahlen Sie entsprechende Gebühren.
Eigener Onlineshop: Mit dem eigenen Shop sind Sie verantwortlich für die Logistik. Das bedeutet, Sie müssen einen Versandprozess einrichten: entweder selbst verpacken und mit Versanddienstleistern verschicken oder einen Fulfillment-Dienst / Logistikpartner beauftragen. Anfangs erledigen viele kleine Händler den Versand eigenhändig (Lagerung zu Hause oder im kleinen Lager, Paketetiketten drucken, zur Post bringen). Das ist aufwendig, aber Sie haben volle Kontrolle über Verpackung und Beilagen (z.B. Branding auf dem Karton, personalisierte Dankesbriefe etc., was bei Amazon-FBA nicht ginge). Sobald das Volumen steigt, kommen 3PL (Third Party Logistics) Anbieter ins Spiel, die ähnlich wie Amazon Lager & Versand für Sie übernehmen. Es gibt mittlerweile auch Fulfillment-Dienstleister, bei denen Sie Shop-Systeme andocken können – Bestellungen aus Ihrem Shop werden automatisch an das Lager übermittelt, wo Kommissionierung & Versand erfolgen. Die Kostenstruktur ist hier oft flexibler verhandelbar, aber es erfordert ebenfalls Gebühren pro Auftrag. Ein eigener Shop bedeutet auch, dass Sie sich um Retourenmanagement kümmern müssen und um Kundenservice bei Versandproblemen. Technisch müssen Sie Versandoptionen in Ihrem Shop integrieren (z.B. verschiedene Versandarten anbieten, Echtzeit-Portokalkulation, Tracking an Kunden schicken). Viele Shopsysteme bieten dafür Plugins oder API-Integrationen zu DHL, Hermes, etc. an. Im Vergleich zu Amazon ist die Logistik im eigenen Shop anfangs mehr Aufwand, aber Sie behalten die Kontrolle. Sie entscheiden, welche Versandkosten berechnet werden, welche Verpackungen genutzt werden und können individuelle Lösungen (z.B. lokale Same-Day-Lieferung, Abholung im Laden) anbieten – Amazon hingegen ist standardisiert auf sein System.
Vergleich: Amazon punktet mit bequemer, skalierbarer Fulfillment-Lösung und Prime-Versand, wodurch auch kleine Händler professionellen Versand anbieten können. Dafür zahlt man jedoch Gebühren und muss gewisse Abstriche bei Kontrolle machen. Beim eigenen Shop tragen Sie die volle Verantwortung für Logistik – was anfangs mehr Einsatz erfordert, Ihnen aber ermöglicht, das Liefererlebnis selbst zu gestalten (und ggf. kostengünstiger zu operieren, je nach Volumen). Technisch bietet Amazon eine fertig aufgebaute Infrastruktur, während Sie beim eigenen Shop zunächst eigene Prozesse entwickeln oder zukaufen müssen. Der Vorteil eigener Logistik: Sie können im Zweifel schneller auf Probleme reagieren und sind nicht abhängig von Amazons Lagerbeschränkungen oder plötzlichen Versandgebührenerhöhungen.
6. Marketingmöglichkeiten
Eigener Onlineshop: Marketing liegt hier voll in Ihrer Hand. Sie können sämtliche Kanäle nutzen, um Traffic und Verkäufe zu generieren: Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) wie Google Ads, Social-Media-Marketing (Instagram, Facebook, Pinterest etc.), Content-Marketing (Blogbeiträge, Ratgeber, Videos), E-Mail-Marketing und mehr. Diese unbegrenzten Marketingmöglichkeiten erlauben es, sehr zielgruppenspezifisch zu werben und Ihre Marke bekannter zu machen. Beispielsweise können Sie mit einem eigenen Shop auf Facebook oder Google genau die gewünschten Kundensegmente ansprechen oder mit Rabatten für Newsletter-Abonnenten arbeiten. Auch Personalisierung auf der Website oder spezielle Landing-Pages für Werbekampagnen sind machbar. Wichtig: Sie haben Zugriff auf Tracking-Daten (Google Analytics etc.) und können den Erfolg Ihrer Marketingmaßnahmen detailliert messen und optimieren. Allerdings erfordert all das Know-how, Budget und Zeit – gerade SEO und organische Strategien brauchen Geduld, bis sie Früchte tragen. Ein Vorteil ist, dass Sie keine Konkurrenzanzeigen auf Ihrer Seite haben und somit Ihr Werbebudget nur Ihrer Marke zugutekommt. Zudem lassen sich Kunden, die einmal gekauft haben, erneut ansprechen (z.B. via E-Mail für Folgekauf), was auf Amazon kaum möglich ist.
Amazon: Eines der Verkaufsargumente von Amazon ist, dass weniger eigenes Marketing nötig sei, um Verkäufe zu erzielen – schließlich kommen die Kunden ja von selbst auf den Marktplatz. Gerade am Anfang sparen Sie tatsächlich den Aufwand, Traffic von extern zu Amazon zu lotsen, da die Käufer bereits da sind. Doch in der Praxis reicht es längst nicht, einfach ein Produkt einzustellen. Die Konkurrenz auf Amazon ist groß, daher müssen Sie auch innerhalb von Amazon Marketing betreiben. Dazu zählt vor allem die Optimierung Ihrer Produktseiten (Amazon-SEO: relevante Keywords in Titel, Bullet Points, Beschreibung) und der Einsatz von Amazon-internen Werbemöglichkeiten wie Sponsored Products, Sponsored Brands etc. Ohne bezahlte Anzeigen bleibt Ihr Angebot schnell unsichtbar in der Masse. Diese Werbekosten auf Amazon kommen zusätzlich zu den Verkaufsgebühren hinzu und können erheblich sein – populäre Suchbegriffe sind teuer, weil viele Händler darum bieten. Amazon-Marketing dreht sich stark um das Gewinnen der Buy Box (der hervorgehobene „In den Warenkorb“-Anbieter auf der Produktseite). Die Buy Box erhält meist der Anbieter mit dem besten Gesamtpaket: günstigem Preis, Prime-Logo (FBA), hervorragenden Bewertungen und schnellen Lieferzeiten. Das übt Druck auf Händler aus, entweder mit niedrigen Preisen oder Werbebudget Sichtbarkeit zu erkaufen – was wiederum die Marge schmälert. Externe Marketingmaßnahmen (etwa Google Ads schalten, die direkt auf Ihr Amazon-Listing verlinken) sind theoretisch möglich, aber selten sinnvoll, da Sie damit Kunden zu Amazon schicken und dennoch Amazon die Kundendaten behält. Einige Marken nutzen dennoch z.B. Social-Media-Kampagnen, um ihre Amazon-Produkte zu pushen (z.B. mit Rabattcodes, die auf Amazon eingelöst werden), insbesondere wenn sie keinen eigenen Shop haben. Insgesamt bietet Amazon also eingeschränkte Marketingmöglichkeiten jenseits der Plattform-eigenen Tools. Ihr Fokus liegt darauf, innerhalb Amazons durch gute Rankings und Sponsored Ads sichtbar zu sein. Off-Amazon-Marketing bringt nur indirekt etwas, da die Kundenbindung nicht bei Ihnen bleibt.
Vergleich: Im eigenen Shop können Sie kreative, vielfältige Marketingstrategien fahren und direkten Branding-Effekt erzielen. Das kostet zwar Aufwand und Geld, aber jeder investierte Euro stärkt Ihre eigene Marke. Auf Amazon profitieren Sie davon, dass bereits Kundenverkehr vorhanden ist, müssen aber im harten Wettbewerb meist dennoch in Amazon Ads und optimierte Listings investieren, um genug Verkäufe zu generieren. Die Marketingausgaben fließen hier in die Plattform (Gebühren für Anzeigen) und kommen primär Ihrer kurzfristigen Sichtbarkeit zugute, weniger dem langfristigen Markenaufbau. Viele Händler sehen Amazon daher eher als Absatzkanal, während sie das eigentliche Marken-Marketing auf anderen Wegen betreiben. Letztlich hat Sichtbarkeit immer ihren Preis – entweder zahlen Sie mit Werbebudget auf Amazon oder mit Marketingbudget für den eigenen Shop. Die Kontrolle darüber, wofür Sie wie werben, ist im eigenen Shop deutlich größer (z.B. könnten Sie in Ihrem Shop bewusst Storytelling und Beratung betonen statt Rabattschlachten), während Amazon eine standardisierte Werbeumgebung vorgibt.
7. Skalierbarkeit
Amazon: Die Nutzung von Amazon kann Ihrem Geschäft eine schnelle Skalierung ermöglichen. Da Amazon die Infrastruktur und den Traffic bereitstellt, kann ein gut laufendes Produkt theoretisch über Nacht tausendfach verkauft werden, ohne dass Sie sich um Serverleistung, Payment-Prozesse oder Versandabläufe (bei FBA) sorgen müssen. Amazon kann enorme Nachfragespitzen abfangen – vorausgesetzt, Sie haben genügend Ware auf Lager und verstoßen nicht gegen Regeln. Gerade mit FBA ist es möglich, das Volumen massiv zu steigern, indem Sie einfach mehr Inventar zu Amazon senden. Außerdem können Sie relativ leicht international skalieren: Ein Listing in weiteren Ländern (Amazon.eu Marktplätze, Amazon.com etc.) erschließt neue Märkte, was Ihr Geschäft global wachsen lässt. Allerdings gehen mit schnellem Wachstum auf Amazon auch Herausforderungen einher: Sie stehen im direkten Wettbewerb mit anderen und ggf. mit Amazon selbst. Wenn Ihr Produkt zum „Bestseller“ wird, läuft man Gefahr, dass Amazon selbst oder neue Händler aufspringen und Marktanteile wegnehmen. Außerdem bleiben die Provisionsraten und FBA-Gebühren auch bei steigendem Umsatz bestehen – d.h. Ihre absoluten Kosten skalieren mit (es gibt kaum Mengenrabatt auf Amazon-Gebühren). Trotzdem ist die Operations-Seite sehr skalierbar: Amazon kann problemlos die Abwicklung von 100 auf 10.000 Bestellungen pro Monat hochfahren, ohne dass Sie dafür interne Prozesse völlig neu erfinden müssen. Viele Händler schätzen, dass sie dank Amazon schneller wachsen konnten, als es alleine möglich gewesen wäre, weil Amazon die „technische Last“ der Skalierung trägt.
Eigener Onlineshop: Einen eigenen Shop zu skalieren erfordert strategische Planung, ist aber ebenfalls gut machbar. Moderne Shop-Technologien (insbesondere SaaS-Lösungen oder Cloud-Hosting) erlauben es, auch hohe Besucher- und Bestellzahlen zu bewältigen – man muss ggf. rechtzeitig in bessere Hosting-Tarife oder leistungsfähigere Infrastruktur investieren. Die größere Herausforderung liegt darin, die Nachfrage zu skalieren: Sie müssen Ihr Marketing entsprechend ausweiten (mehr Werbebudget, mehr Kanäle) und eventuell neue Märkte aktiv erschließen (z.B. fremdsprachige Shop-Versionen, lokalisierte Werbung), was mit Aufwand verbunden ist. Vorteilhaft ist, dass Erfolg im eigenen Shop vollständig Ihrem Unternehmen zugutekommt – Sie behalten die zusätzlichen Gewinne, anstatt anteilig mehr Gebühren zu zahlen. Dennoch muss man berücksichtigen, dass alle Prozesse mitwachsen müssen: Kundenservice, Lager, Versand, Zahlungsabwicklung. Sie haben die Freiheit, Tools und Prozesse bei Wachstum anzupassen oder zu automatisieren (z.B. Einführung eines ERP-Systems, Outsourcing der Logistik an ein Fulfillment-Center wie Monta etc.), was aber in Ihrer Verantwortung liegt. Skalierbarkeit ist also gegeben, erfordert aber aktive Investitionen in Team und Infrastruktur. Positiv zu erwähnen: Ein eigener Shop skaliert unabhängig, d.h. Ihr Wachstum hängt nicht von der Laune einer Plattform ab. Wenn etwa Amazon seine Regeln ändert oder Rankings durcheinanderwürfelt, kann das schlagartig Verkäufe kosten – im eigenen Shop greifen solche plötzlichen externen Effekte weniger direkt ein (abgesehen von Dingen wie Google-Algorithmus-Updates, die SEO beeinflussen können). Viele Unternehmen nutzen heute eine Multichannel-Strategie, um Skalierung breiter abzustützen: Sie verkaufen parallel im eigenen Shop und auf Marktplätzen, um möglichst viele Kanäle zu nutzen und das Wachstum zu beschleunigen. Das verteilt zwar Risiken und erhöht Reichweite, bedeutet aber auch erhöhten Management-Aufwand.
Vergleich: Amazon erlaubt oft einen schnelleren “Hochlauf” des Geschäfts, weil Infrastruktur und Kundenstamm schon da sind – dafür entsteht aber auch eine Abhängigkeit (siehe nächster Punkt), die im Extremfall Wachstum wieder ausbremsen kann (z.B. wenn Amazon Limits setzt oder Mitbewerber Druck machen). Der eigene Shop wächst typischerweise organischer und langsamer, kann dafür aber nach eigenen Regeln skaliert werden. Wer ein Produkt hat, das viral geht, erreicht über Amazon kurzfristig mehr Menschen; wer hingegen nachhaltig und kontrolliert wachsen will, setzt auf den eigenen Shop als stabile Basis und nutzt Marktplätze ergänzend. Im Idealfall bringt man sein Unternehmen an den Punkt, wo Amazon ein Kanal von mehreren ist und das Wachstum ergänzt, während der eigene Vertriebskanal das Fundament bildet.
8. Risiken und Abhängigkeiten
Amazon (Marktplatz): Wenn Sie sich für Amazon entscheiden, begeben Sie sich in eine starke Abhängigkeit von einer Plattform. Amazon diktiert die Regeln: Ändert Amazon seine Richtlinien, Gebühren oder den Suchalgorithmus, kann das Ihr Geschäft unmittelbar treffen. Beispielsweise hat Amazon in der Vergangenheit Vertriebsbeschränkungen für bestimmte Marken eingeführt und Marketplace-Händlern den Verkauf diverser Markenprodukte plötzlich untersagt. Solche Entscheidungen liegen außerhalb Ihrer Kontrolle. Zudem ist Amazon selbst ein Wettbewerber auf dem Marktplatz – verkauft ein Händler ein sehr erfolgreiches neues Produkt, kommt es vor, dass Amazon dieses Produkt selbst ins Sortiment aufnimmt (ggf. direkt vom Hersteller) und zu günstigeren Preisen anbietet. Kleinere Händler können dadurch verdrängt werden. Ein großes Risiko ist auch die Konkurrenz und Preisdruck: Da auf Amazon viele Anbieter das gleiche oder ähnliche Produkte verkaufen, entsteht oft ein Unterbietungswettbewerb, bei dem am Ende die Marge leidet. Wer nicht der günstigste Anbieter ist (bei vergleichbarem Service), verliert schnell die Buy Box und damit den Großteil der Verkäufe. Kundenloyalität existiert kaum, daher sind Händler ersetzbar. Weiterhin trägt man auf Amazon das Risiko von Konto-Sperrungen: Schon ein Verstoß gegen Amazons Regeln – sei es unbeabsichtigt – oder eine Häufung von Kundenbeschwerden kann dazu führen, dass Ihr Verkäuferkonto vorübergehend oder dauerhaft gesperrt wird. Dies bedeutet Umsatzausfall von einem Tag auf den anderen. In solchen Fällen sind Händler Amazon oft ausgeliefert und müssen auf Kulanz oder komplizierte Einspruchsverfahren hoffen. Kurz: Ihr Business kann am „seidenen Faden“ Amazon hängen. Viele erfolgreiche Amazon-Händler wissen, dass ihr aktueller Erfolg sich jederzeit ändern kann, etwa wenn ein Konkurrent mit Dumpingpreisen auftaucht oder Amazon die Spielregeln ändert. Diese Abhängigkeit ist ein erhebliches Geschäftsrisiko.
Eigener Onlineshop: Mit einem eigenen Shop sind Sie weitgehend unabhängig von Drittparteien – Ihr Kunde gehört „Ihnen“, nicht einem Vermittler. Die Risiken liegen hier eher in unternehmerischen Aspekten: Schafft es Ihr Shop, genügend Kunden zu gewinnen? Ein Scheitern des eigenen Shops bedeutet, dass man Investitionen in Aufbau und Marketing verliert. Allerdings haben Sie das selbst in der Hand durch Ihre Strategie. Technische Risiken gibt es auch (z.B. kann ein Shop gehackt werden oder ausfallen, wenn er schlecht gewartet wird), doch mit sicheren Lösungen und Backups ist das managbar. Rechtliche Risiken (Abmahnungen wegen fehlerhafter Angaben, Datenschutz etc.) müssen ebenfalls beachtet werden – im eigenen Shop sind Sie dafür selbst verantwortlich, während Amazon Ihnen zumindest bei Marktplatz-Verkauf viele rechtliche Anforderungen (z.B. an den Checkout) abnimmt. Ein oft unterschätzter Abhängigkeitsfaktor beim eigenen Shop: Man ist auf Traffic-Zulieferer angewiesen, vor allem auf Google. Ändert Google seinen Suchalgorithmus und Ihre Rankings brechen ein, kann das den Besucherzustrom beeinträchtigen – hier besteht also eine indirekte Abhängigkeit vom Suchmaschinenmarkt. Dennoch bleibt ein eigener Shop ein Asset Ihres Unternehmens: Sie können die Plattform wechseln, den Shop relaunchen, die Strategie ändern, ohne dass Ihnen jemand plötzlich den Stecker zieht. Die Hoheit über Geschäftsprozesse liegt bei Ihnen. Das größte Risiko ist hier vermutlich die unternehmerische Verantwortung: Ohne Fleiß kein Preis – wer nicht kontinuierlich in Shop-Optimierung und Kundengewinnung investiert, wird eventuell scheitern. Aber diese Art von Risiko können Sie durch Planung und Qualität selbst steuern.
Vergleich: Auf Amazon tragen Sie ein plattformimmanentes Risiko: hohe Abhängigkeit und Fremdbestimmung (ähnlich wie bei Social-Media-Plattformen, wo ein Account auch jederzeit gesperrt werden kann). Ein eigener Shop erfordert zwar mehr Eigenleistung, birgt aber nicht die Gefahr, dass ein externer Akteur Ihnen über Nacht die Geschäftsgrundlage entzieht. Viele Händler empfinden dies als die entscheidende Abwägung: Kurzfristiger Erfolg vs. langfristige Unabhängigkeit. Deshalb raten Experten oft, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern z.B. Amazon für schnellen Umsatz zu nutzen, gleichzeitig aber einen eigenen Shop aufzubauen, um ein zweites Standbein zu haben. Eine diversifizierte Strategie reduziert Abhängigkeiten und Risiken erheblich.
9. Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile im Überblick
Zur besseren Übersicht sind hier die wichtigsten Punkte der beiden Verkaufsoptionen Eigener Onlineshop vs. Verkauf über Amazon gegenübergestellt:
| Aspekt |
Eigener Onlineshop |
Amazon (Marketplace) |
| Kosten |
- Anfangsinvestition in Shop-Entwicklung/Design
- Laufende Fixkosten (Hosting, Shopsystem, Plugins)
- Keine Verkaufsprovisionen an Dritte – nur Zahlungsgebühren
- Marketingkosten nötig für Traffic
|
- Geringe Startkosten: Verkäuferkonto + Lagerbestand
- Laufende Gebühren: 39 €/Monat (Pro-Konto) + ~8–15% Provision pro Verkauf
- Zusätzliche Kosten für FBA (optional) und Amazon-Werbung
- Weniger Eigen-Marketing anfangs nötig
|
| Reichweite & Zugang |
- Muss selbst aufgebaut werden (SEO, Ads, Social Media) – dauert Zeit
- Anfangs kein vorhandener Traffic – aktive Kundengewinnung nötig
- Volle Kontrolle über Zielgruppe, Möglichkeit Stammkunden aufzubauen
|
- Enorme Reichweite von Beginn an (Millionen Käufer)
- Kunden suchen gezielt auf Amazon (50%+ aller Produktsuchen)
- International leicht zugänglich (mehrere Länder mit einem Account)
- Vertrauen der Kunden in Plattform vorhanden
|
| Markenbildung |
- Individuelle Markenpräsentation (Design, Content frei gestaltbar)
- Markenidentität aufbauen (eigener Look&Feel, eigene Story)
- Kundenbindung durch eigenen Auftritt und direkte Ansprache (Newsletter, Community)
|
- Marke tritt in den Hintergrund – Kunde nimmt primär „Amazon“ wahr
- Begrenztes Branding (einheitliche Amazon-Listings, kaum Differenzierung)
- Keine direkte Kundenbindung – Käufer gehören der Plattform, kaum Wiederkehreffekte
|
| Design & Kontrolle |
- Volle Kontrolle über Shop-Design und UX (keine externen Vorgaben)
- Eigene Features und Prozesse umsetzbar (z.B. besondere Checkouts, Produktauswahl-Hilfen)
- Datenhoheit: Zugriff auf Kundendaten und Statistiken zur Optimierung
|
- Standardisiertes Layout und Shop-System, strikte Richtlinien
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten der Produktseiten
- Keine Kundendaten für eigenes CRM (Amazon gibt Daten nicht frei)
- Prozesse (Zahlung, Checkout) werden von Amazon vorgegeben
|
| Logistik & Versand |
- Eigenverantwortlich: Muss Versandlogistik aufbauen oder Partner nutzen
- Volle Kontrolle über Verpackung, Lieferdienst, Retourenabwicklung
- Flexibel: spezielle Versandoptionen oder Branding beim Paket möglich
- Bedarf an eigener Infrastruktur steigt mit Bestellvolumen
|
- FBA-Service vorhanden: Amazon lagert, packt, versendet (Prime)
- Schnelle Lieferung (1–2 Tage mit Prime) steigert Kaufbereitschaft
- Hohe Versandstandards vorgegeben (nötig für gute Performance)
- Gebühren für FBA & Versand, weniger Kontrolle (Amazon entscheidet Ablauf)
|
| Marketing |
- Vielfältige Kanäle: SEO, SEA, Social Media, E-Mail, Content etc. nach Belieben nutzen
- Gezielte Zielgruppenansprache möglich, Branding-Effekte
- Retargeting & Newsletter: Kunden erneut ansprechen möglich
- Analyse: volles Tracking zur Erfolgsmessung
|
- Interne Amazon Ads fast unumgänglich für Sichtbarkeit (zusätzliche Kosten)
- Amazon-SEO: Listing-Optimierung nach Plattform-Kriterien
- Begrenzte Marketingmöglichkeiten außerhalb Amazon (kein direkter Kundenkontakt)
- Anfangs weniger eigener Aufwand nötig, da Traffic vorhanden
|
| Skalierbarkeit |
- Skalierbar nach eigenen Regeln: Prozesse selbst anpassbar bei Wachstum
- Investitionen in Technik und Personal, wenn Bestellungen stark steigen
- Kein Deckel: Shop gehört Ihnen, Wachstum nur durch eigene Kapazitäten begrenzt
- Zeitlich langsamerer Aufbau, dafür organisch und unabhängig
|
- Hochgradig skalierbar durch Amazons Infrastruktur (Lager, Server, weltweiter Markt)
- Schneller Hochlauf möglich, wenn Produkt gefragt ist (Amazon kann Nachfrage bedienen)
- Skalierungskosten: Gebühren steigen mit Umsatz linear mit
- Risiko bei plötzlichem Wachstum: zieht evtl. Konkurrenz oder Amazon selbst an
|
| Risiken & Abhängigk. |
- Unabhängigkeit: Keine plötzlichen Account-Sperren durch Dritte
- Volle Verantwortung – Erfolg oder Misserfolg liegen an eigener Strategie (Risiko des Scheiterns bei ausbleibendem Erfolg)
- Rechtliche Risiken (z.B. Abmahnungen) selbst zu managen
- Weniger Angriffspunkte durch externe Regeländerungen (aber Abh. von Google/Social Traffic)
|
- Starke Abhängigkeit von Amazon: Regeländerungen oder Verbote können Geschäft lahmlegen
- Konto-Sperrungen als Damoklesschwert (Umsatz abrupt weg)
- Hoher Wettbewerb & Preisdruck – ständiger Konkurrenzkampf, dünne Margen möglich
- Amazon als Mittler und Konkurrent (kann erfolgreiche Produkte selbst verkaufen)
|
(Legende: FBA = Fulfillment by Amazon; SEO = Suchmaschinenoptimierung; SEA = Suchmaschinenwerbung)
10. Fazit und Entscheidungshilfe
Einen klaren Gewinner gibt es nicht – die passende Verkaufsstrategie hängt von Ihrer individuellen Situation, Ihren Zielen und Ressourcen ab. Beide Optionen können erfolgreich sein, bedienen aber unterschiedliche Prioritäten:
Amazon eignet sich besonders, wenn Sie schnell und ohne großen Vorlauf verkaufen möchten. Haben Sie ein Produkt, das eine breite Nachfrage bedienen kann, und wollen Sie rasch Reichweite erzielen, bietet Amazon den direkten Zugang zu Millionen von Kunden. Auch wenn Ihr Budget oder Know-how für eigenes Webdesign/Marketing begrenzt ist, kann Amazon ein einfacher Einstieg sein. Sie müssen sich nicht um die Shop-Technik kümmern und profitieren vom Vertrauen in Amazons Einkaufsprozess. Nachteilig sind allerdings die Abhängigkeit und der Margendruck: Kalkulieren Sie ein, dass Gebühren und Preiskampf einen Teil Ihres Gewinns aufzehren. Außerdem sollten Sie Amazon nicht als langfristige Branding-Plattform betrachten – es ist vor allem ein Absatzkanal. Wenn Sie einfach nur nebenbei ein paar Produkte verkaufen oder Marktpotenzial testen wollen, ist Amazon ideal, weil es unkompliziert startet und wenig Fixkosten verursacht.
Ein eigener Onlineshop lohnt sich, wenn Ihnen Markenaufbau, Kundendaten und Unabhängigkeit wichtig sind. Wollen Sie ein nachhaltiges E-Commerce-Business aufbauen, eine Marke etablieren oder ein Nischenprodukt mit intensiver Beratung verkaufen, spielen die Stärken des eigenen Shops ihre volle Wirkung aus. Sie investieren zwar mehr zu Beginn und brauchen Geduld, aber dafür schaffen Sie einen Wert, der Ihnen gehört – Ihre eigene Plattform mit eigenen Kunden. Besonders für höherpreisige oder erklärungsbedürftige Produkte kann ein eigener Shop vorteilhaft sein, da Sie hier ausführlich informieren und kundenindividuell beraten können. Auch behalten Sie 100% der Kontrolle über Preisgestaltung und Gewinnmargen. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie bereit sind, Zeit und Geld in Marketing und Shop-Pflege zu stecken, da der Erfolg nicht automatisch kommt.
Viele erfahrene Händler empfehlen heute einen Mix aus beiden Welten: Nutzen Sie Amazon, um schnell Umsatz zu generieren und Reichweite aufzubauen, aber parallel dazu Ihren eigenen Onlineshop, um ein stabiles Fundament für Ihre Marke zu legen. So können Sie die Vorteile beider Kanäle kombinieren und Risiken streuen. Zum Beispiel könnten Sie anfangs auf Amazon starten, um Erfahrungswerte zu sammeln und Kapital zu erwirtschaften, und dann Schritt für Schritt Ihren Shop ausbauen. Oder Sie bieten auf Amazon ausgewählte Bestseller an, während im eigenen Shop das gesamte Sortiment und exklusive Produkte erhältlich sind. Wichtig ist, dass Sie bei einer Multichannel-Strategie darauf achten, Preise und Marke konsistent zu halten, um Kunden nicht zu verwirren – die Kanäle sollten sich ergänzen, nicht kannibalisieren.
Zusammengefasst: Entscheiden Sie sich für Amazon, wenn schnelle Reichweite, einfacher Start und bestehende Infrastruktur Ihre Hauptkriterien sind – wohl wissend, dass Sie einen Teil der Kontrolle abgeben und mit Konkurrenzdruck leben müssen. Setzen Sie auf einen eigenen Onlineshop, wenn Markenaufbau, Flexibilität und direkte Kundenbeziehung im Vordergrund stehen – im Bewusstsein, dass Sie mehr Eigenleistung und Zeit investieren müssen, bevor der Erfolg sichtbar wird. Im Zweifel kann die Kombination aus beiden den besten Erfolg versprechen, da Sie so kurzfristige Verkäufe und langfristige Wertschöpfung verbinden können. Nutzen Sie die Informationen dieses Ratgebers, um abzuwägen, was für Ihr Geschäftsmodell passt, und treffen Sie eine informierte Entscheidung für Ihre E-Commerce-Zukunft!